Corona hat die Wirtschaft hart getroffen. Unternehmen wanken, Arbeitsplätze sind in Gefahr. Was tun? Sechs Orientierungsmarken von Stefan Perini.
Leben
Der Große Schulversuch
Aus ff 16 vom Donnerstag, den 16. April 2020

Kommt nach der Gesundheitskrise die Bildungskrise? Wie gut – und wie schlecht – der Unterricht daheim funktioniert. Wer davon profitiert und wer darunter leidet.
Die Zahlen: 16.600 im Kindergarten, 27.800 in der Grundschule, 17.500 in der Mittelschule, 20.000 in der Oberschule, 10.300 in den Berufsschulen.
Gut 74.000: So viele Schülerinnen und Schüler zählt Südtirol (laut Landesinstitut für Statistik Astat). Sie sitzen seit dem 4. März daheim und werden von Lehrpersonen unterrichtet, die ebenfalls daheim sitzen. Schüler und Lehrpersonen sehen sich nur mehr selten. Und wenn, dann auf einem Bildschirm, falls die Internetverbindung hält. Oder falls die Schüler zuhause überhaupt über einen Computer verfügen.
Wie soll das gehen und vor allem wie lange? Bedeutet das einen Knick für die Bildungskarrieren? Oder hat es gar einen Nutzen – werden Schüler selbständiger und die Schule endlich richtig digital?
Über Nacht wurde die Schule auf einen fremden Planeten katapultiert. Auf den Planeten Fernunterricht, die Schule ist jetzt gezwungenermaßen digital. Nach diesem rasanten Flug war erst einmal allen Beteiligten ein paar Wochen schwindlig. Ganz hat die Schule sich noch nicht vom Schwindel erholt, auch wenn die Verantwortlichen für Bildung Optimismus verbreiten (siehe Interview mit Philipp Achammer auf Seite 36). Und die Lehrpersonen in einem Crashkurs lernen, wie man mit Google Classroom oder Microsoft Teams umgeht, Eltern und Schüler das digitale Klassenbuch entdecken – Dinge, von denen sie vorher oft nur einen blassen Schlimmer hatten.
Maximilian, 18, dachte sich, als die Schule schloss: „Super!“ Jetzt sagt er: „Ich sehne die Schule herbei und mit ihr natürlich die Aufhebung der Ausgangssperre.“
M. L. unterrichtet seit sieben Jahren in einer Grundschule in Bozen: „Wir haben mehr zu tun als vorher. Es ist richtig schwierig, die Kinder zu motivieren, weil der direkte Kontakt fehlt.“ Sie arbeitet im Moment mehr als sonst, manchmal ploppt auch in der Nacht noch eine WhatsApp-Nachricht auf. Nicht alle Gesprächspartner wollten in der Geschichte mit ihrem (richtigen) Namen aufscheinen, sie fürchten Unannehmlichkeiten, wenn sie Kritik an der Schule üben.
„Schule“, sagt Heidi Niederkofler, Direktorin des Schulsprengels Bozen-Europa, „hat jetzt mehr einen gesellschaftlichen Auftrag: Die Gesellschaft zusammenzuhalten. Aber es ist ein Drahtseilakt.“ Niederkofler muss sich um die Lehrpersonen sorgen, um das Personal, das nicht unterrichtet, um die Schüler, vor allem um die Kinder mit Migrationshintergrund, deren Familien sich ins Ausland geflüchtet haben. „Die Schulpflicht“, sagt sie, „ist nicht aufgehoben.“
Simone Wasserer ist Mutter von drei Kindern, eines im Kindergarten, eines in der Grundschule und eines in der Mittelschule. Wasserer ist eine engagierte Frau, sie war Gleichstellungsrätin des Landes Südtirol, sie ist Gemeinderätin für die SVP in Innichen, sie führt zusammen mit ihrem Mann ein Hotel mit 80 Betten. Doch jetzt ist auch sie manchmal überfordert.
Wasserer hat daheim eine kleine Schule eingerichtet, Unterricht von 10-12 und von 16-18 Uhr, der Tag ist ziemlich strukturiert. „Es ist“, sagt sie, „ein Fulltimejob, eine Situation, die an den Nerven zehrt, weil wir nicht wissen, wann die Schule wieder öffnet und wann wir den Betrieb aufsperren können. Was tun wir, wenn wir das Hotel offen haben und die Kinder daheim sind?“
Antolin heißt eines der Programme, mit denen ihren Kinder gerade lernen. Leseförderung digital, doch gerade Grundschulkinder müssen erst lernen, mit den Programmen umzugehen. Wie sollen Kinder der ersten Klasse, die erst lesen und schreiben gelernt haben, das begreifen? Vor allem Kinder in der Grundschule brauchen die Zuwendung der Lehrpersonen, einen aufmunternden Blick, ein Lächeln, die Gewissheit, dass es nicht an ihnen liegt, wenn etwas nicht klappt.
„Du musst“ sagt Simone Wasserer, „mit deinem Kind zusammenkommen, ohne dass einer durchdreht. Ich weiß ja manchmal gar nicht, wie ich ihnen die Sachen erklären soll. Noch geht es. Und es ist besser geworden in den letzten Wochen.“
Doch ohne Scanner und Drucker geht es nicht. Manches lässt sich am Computer lösen, manches muss ausgedruckt, eingescannt oder fotografiert und wieder verschickt werden. Nicht alle Familien sind technisch hochgerüstet, manche Schüler schwer oder gar nicht erreichbar. Manche Lehrer melden sich jeden Tag, von manchen haben die Schüler seit Wochen nichts mehr gehört.
Die Schule ist ein idealer Ort für die Verbreitung des Coronavirus, auch wenn Kinder und Jugendliche weniger von Covid-19 betroffen sind und die Krankheit meistens eine leichten Verlauf nimmt: kleine Klassen, überfüllte Schulbusse, enger Kontakt beim Sport oder in den Mensen – einer rotzt oder hustet immer.
In einer Woche, dachten alle in der ersten Märzwoche, sind wir wieder da. Ihre Kinder, erzählt eine Mutter, seien regelrecht euphorisch nach Hause gekommen: keine Schule mehr. Jetzt, sagt sie, würden sie sich nach Schule sehnen. In manchen Klassen, erzählt die Grundschullehrerin M.L., hingen noch die verschwitzten Leibchen vom Turnen. „Der Gedanke, die Kinder in diesem Schuljahr nicht mehr zu sehen, macht mich traurig.“
Jetzt wird in ganz Europa darüber gestritten, wann die Schule wieder geöffnet wird. In Deutschland hat die Leopoldina, ein nationales Forschungsinstitut, eine schrittweise Öffnung empfohlen, zuerst die Großen, die besser mit einer Schutzmaske umgehen können, und es verstehen, Abstand zu halten.
Es ist gut möglich, dass die Schule in Italien, und damit auch in Südtirol, erst wieder im Herbst öffnet. Denn wie sollte das gehen, Abstand halten? Dafür sind die Schulgebäude nicht ausgelegt, der Unterricht könnte nur in kleineren Gruppen stattfinden, der Schultransport müsste entweder potenziert oder gestaffelt, der Mensadienst völlig anders organisiert werden.
Die Schule jetzt zu öffnen, wäre neben dem Ansteckungsrisiko eine gewaltige logistische Herausforderung. Regulär endet das Schuljahr 2019/2020 am 16. Juni.
„Ich kann mir vorstellen, dass es eine schrittweise Rückkehr in die Klassenzimmer gibt“, sagt Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner, „das genaue Datum ist, zum Glück, nicht unsere Entscheidung, es wird in Rom bestimmt.“ Wenn es um die Schule geht, hat Südtirol laut Autonomiestatut nur sekundäre Kompetenzen.
Doch wann die Schule wieder vom digitalen zum guten alten analogen Unterricht wechseln kann, darüber gibt auch das letzte Dekret von Unterrichtsministerin Lucia Azzolina vom 8. April keine genaue Auskunft. Es teilt die Schulwelt in die Zeit vor dem 18. Mai und in die Zeit danach ein. Sollte Unterricht in physischer Form nicht vor dem 18. Mai möglich sein, fließt der Fernunterricht in die Bewertung ein, entfällt die Mittelschulprüfung, die Bewertung erfolgt aufgrund der Noten im Schuljahr, Schüler müssten freilich stattdessen eine Hausarbeit („tesina“) erstellen; die Matura bestünde aus einer großen mündlichen Prüfung vor einer internen Kommission, alle wären zur Matura zugelassen.
„Jede Klarstellung“, sagt Piero di Benedetto, Direktor des Schulsprengels Meran-Stadt (dazu gehört auch die Mittelschule Burgstall) wirft gleichzeitig neue Fragen auf, eine Planung ist derzeit so gut wie unmöglich.“ Der Schulsprengel Meran-Stadt ist der größte in Südtirol: 1.000 Schüler, 150 Lehrpersonen.
Was sich jetzt zeigt, sind die Unterschiede in der Schule: Die Unterschiede zwischen den Lehrern – die einen mussten gebremst werden, packten den Schülern zu viel auf – das Schulamt mahnte zur Zurückhaltung mit den Arbeitsaufträgen, andere sind vom Radar verschwunden; zwischen den Schülern – die einen selbständig, die anderen, die man an der Hand nehmen muss, gar einige, die sich über Wochen nicht melden oder nicht erreichbar sind; zwischen den Familien, die gut ausgestattet sind und denen, die keinen oder nur einen Computer zuhause haben, nicht über Drucker oder Scanner verfügen; zwischen Gemeinden, in denen die Internet-Verbindung gut ausgebaut, und Gemeinden, in denen das Bild ständig ruckelt. Der Fernunterricht verschärft die (sozialen) Unterschiede.
„Wir müssen aufpassen“, sagt Ulrike Stadler-Altmann, Professorin für Allgemeine Didaktik an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bozen, „dass wir nach der Coronakrise nicht eine Bildungskrise bekommen. Kinder, die zuhause keine oder wenig Unterstützung haben, sind jetzt noch benachteiligter als ohnehin schon.“
Marlies Tasser ist seit Herbst 2019 die Koordinatorin der Digi-Coaches – sie ist vom Unterricht an der WFO in Bruneck freigestellt. Die Digi-Coaches, das sind die Leute, die Konzepte für die Medienbildung an den Schulen erstellen, technische Fragen klären, Computer und Lernplattformen empfehlen.
Im Moment ist Marlies Tasser die Kommandantin der digitalen Feuerwehr in der Südtiroler Schule, sie und ihr Team müssen den Lehrpersonen weiterhelfen, wenn sie einen Notstand haben. Denn in der Schule arbeiten Menschen, die digital gerüstet sind, und Menschen, die die Digitalisierung für Teufelswerk halten.
Auch die Schüler, die so genannten „digital natives“, sind im Umgang mit Programmen manchmal ebenso wenig geübt wie die Lehrpersonen. Es gibt in Südtirol digitale Klassen, in denen jeder Schüler seinen Laptop in die Klasse bringt (etwa am Realgymnasium in Meran), die Aufgaben im Netz erledigt werden, doch das ist eher die Ausnahme als die Regel. „Wir sind“, sagt Tasser, „nicht auf einem Punkt.“ „Die Schule“, sagt Petra Nock, Sekretärin der Schulgewerkschaft im ASGB, „muss digital aufrüsten.“
Manche Lehrer kommunizieren über E-Mail mit den Schülern – so kommen dann an einem Tag auch schon einmal 60 E-Mails zusammen; manche haben eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, auf der Fotos oder Hausaufgaben hochgeladen werden können (Vorsicht mit dem Datenschutz, mahnt Marlies Tasser); manche stellen ihre Aufgaben ins digitale Register inklusive Abgabeterminen – die Schüler wiederum schicken die Aufgaben auf dem selben Weg retour.
Wer in der digitalen Welt heimischer ist, verwendet Google Classroom oder Microsoft Teams (dafür braucht es freilich ein Programm wie Microsoft Office 365) oder den Bildungsserver des Landes „Blikk“ mit der Möglichkeit, Blogs einzurichten – über 300 sind derzeit aktiv. Mit Microsoft Teams lässt sich theoretisch der Unterricht papierlos bewerkstelligen: Videokonferenzen, Notizbücher mit Materialien und Abgabeterminen, Feedback der Lehrpersonen. Keine Ausdrucke, kein Papier, keine komplizierten Scans.
H. S. arbeitet als Mathematiklehrerin an einer Oberschule, sie macht diesen Job erst seit ein paar Jahren, sie arbeitet mit Microsoft Teams, verschickt selbstgedrehte Lernvideos, die Arbeitsaufträge beziehen sich auf das Video. Die Eigenständigkeit der Schüler habe zugenommen, sagt sie. Aber gerade die Schüler, die es nötig hätten, nützten die Möglichkeit nicht, sich mit ihr auszutauschen: „Es fehlt die Kommunikation mit den Schülern, viele hören einfach zu, aber man weiß nicht, wie aufmerksam sie sind oder ob sie die Aufgaben selber gelöst haben.“ Sie arbeite im Moment um die 60 Stunden in der Woche für die Schule.
„Natürlich“ sagt Sigrun Falkensteiner, „waren wir nicht auf diesen Bruch vorbereitet, wir sind im Moment alle Lernende.“
Schulämter und Schulen bemühen sich: Sie verleihen an Laptops, was sie haben (die Alpini übernehmen die Zustellung) – aber sie haben keine mehr, stellen Programme wie Microsoft Office kostenlos zur Verfügung oder kaufen Datenmengen an, die den Familien zur Verfügung gestellt werden. Die Stiftung Sparkasse spendiert 400 Laptops: Doch woher nehmen im Moment, wo alle einen wollen?
„Die Zeit, diese ekelhafte Schnecke“, hat Lena, 2. Klasse Oberschule, in ihr Tagebuch geschrieben, „zieht sich wie ein Kaugummi zwischen den Fingern, zäh, gleichförmig, klebrig.“ Ihr fehlt die Gemeinschaft, sie unterhält sich stundenlang mit ihren Schulkolleginnen per Videochat, manchmal bekommt sie einen Stress, weil sie zwei Tage lang nicht ins digitale Register geschaut hat, sie dreht jetzt sogar Videos, statt trockene Referate zu schreiben. Sie sagt, sie befasse sich jetzt näher mit den Sachen, sie könne sich deshalb Inhalte besser merken. Und dann wieder steht in ihrem Tagebuch: „Ich bin am Verzweifeln, jeder Tag ist gleich.“
Maria, 16, macht im Moment nicht viel, eine halbe Stunde am Tag arbeitet sie für die Schule. Die Physiklehrerin meldete sich einen Tag nach der Schließung der Schule, verschickte Arbeitsaufträge, jetzt steht ein Test an; der Mathematiklehrer tauchte eine Woche später auf dem Schirm auf, er hat ein paar YouTube-Videos geschickt, jetzt hat Maria seit vier Wochen nichts mehr von ihm gehört; der Philosophielehrer prüft per Videoschalte; der Englischlehrer übergibt digital ein wöchentliches Arbeitspaket; in Naturkunde bekommt jeder die gleichen Fragen, die Antworten zirkulieren dann unter den Schülern; bei den Tests versuchen viele zu schwindeln, indem sie sich Spickzettel auf die Hinterseite des Laptop kleben „Ich möchte die Schule zurück, wie sie vor der Coronakrise war“, sagt Maria, „in die Schule gehen, ist cooler.“
Lisa Fulterer, Maturantin am Vinzentinum in Brixen, sagt: „Das System funktioniert den Umständen entsprechend gut, aber die Institution Schule ersetzt es nicht.“
Die Universitätsprofessorin Ulrike Stadler-Altmann ist jetzt daheim in Erlangen bei ihrer Familie, ihrer Tochter steht kurz vor dem Abitur. Wichtig im Fernunterricht, sagt sie, sei es, Interaktion zuzulassen, miteinander zu sprechen, Nachfragemöglichkeiten zuzulassen, zu regelmäßigen Zeiten mit Kindern und Jugendlichen Kontakt zu halten, dem Tag eine Struktur zu geben, sich auch abzugrenzen oder Hilfe zu holen. „Die Schüler“, sagt sie, „brauchen das Gefühl, dass Lernen daheim sich lohnt. Die Aussage, alle werden versetzt, ist ein maximaler Motivationskiller.“
Eine Grundschule im Eisacktal wirft seit ein paar Wochen am Montagnachmittag digital ein Aufgabenpaket ab. Das war es dann für die restliche Woche, erzählen die Eltern, die ihre Kinder daheim unterrichten. Dann höre man nichts mehr von den Lehrerinnen, keine Videokonferenz, keine Anrufe.
Wie soll ein Kind in der Grundschule diese Art von Fernunterricht meistern? Eigentlich gar nicht, sagt Annemarie Augschöll, Professorin an der Universität Bozen. Sie unterrichtet dort Geschichte der Pädagogik, sie erforscht, wie die Schule Menschen prägt. Augschöll beobachtet an ihren Kindern (Oberschüler), wie sie sich jetzt selber organisieren. Auch die Universität hat jetzt den Fernunterricht angeworfen, Augschöll hält ihre Vorlesungen per Videokonferenz.
Ich mache mir Sorgen um die Kinder in der Grundschule, sagt sie.
Warum?
Es ist für sie eine entfremdende Situation. Sie brauchen Begleitung, Beziehung, es genügt nicht, einmal in der Woche Arbeitsaufträge zu geben. Kleinere Kinder beziehen es schnell auf sich, wenn etwas nicht klappt.
Warum ist Beziehung wichtig?
Für die Motivation. Die Kinder motivieren sich gegenseitig. Die Kinder brauchen den Kontakt, und sei es auch nur ein aufmunternder Blick oder ein Lächeln. Kinder brauchen das Gefühl, wahrgenommen zu werden.
Wie lange also ist Fernunterricht machbar?
Nur für eine bestimmte Zeit. Denn ihren eigentlichen Auftrag kann Schule nicht erfüllen, Kinder in die Gemeinschaft einzuführen, deren Regeln zu erlernen und gleichzeitig kritisch zu reflektieren, die Techniken auszuprobieren, die uns helfen, die Kultur zu erschließen und zu gestalten, und Eigenwahrnehmung und Weltverständnis zu erweitern.
M.L. erlebt in der Praxis, was Annemarie Augschöll in der Theorie darlegt: das Leiden „ihrer“ Kinder am fehlenden Kontakt, die Schwierigkeiten, die vor allem Kinder in den ersten Klassen haben, die Migrantenkinder, die aufgrund von Sprachproblemen kaum Unterstützung durch die Eltern bekommen, die fehlende Medienkompetenz der Kinder aufgrund der schlechten technischen Ausstattung der Schule. „Die Leistungsschere“, sagt sie, „geht jetzt weit auseinander, das werden wir im Herbst erst einmal aufholen müssen.“
„Die Schule“, erklärt Simone Seitz, „hat die zentrale Aufgabe, alle Kindern gleichermaßen Zugang zu Bildung zu gewähren, aber jetzt sind die Eltern die Lehrer und Familien haben natürlich ungleiche Voraussetzungen. Bildungsgerechtigkeit lässt sich so schwer herstellen, auch wenn Lehrpersonen darauf schauen, dass niemand durch das Netz fällt. Kinder sind sehr auf sich zurückgeworfen in dieser Lage.“ Seitz hat im Januar begonnen, als Professorin an der Uni in Brixen zu arbeiten, als Professorin für allgemeine Didaktik und Inklusion.
Piero di Benedetto, der Direktor der Schulsprengels Meran-Stadt, und Ulrike Hofer, Direktorin des Schulsprengels Vintl, haben alle Hände voll zu tun, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Manchmal müssen sie in die Schule, um Unterlagen für die Heimarbeit zu holen. Dann überfällt sie Wehmut angesichts der leeren Klassen. Di Benedetto hat etwa keine Laptops mehr, die er verleihen könnte, er hat an seiner Schule den Fernunterricht völlig neu aufstellen müssen, er sieht, wie alle manchmal überfordert sind, er beobachtet bei seinen Lehrern eine große Resilienz (laut Wörterbuch „psychische Widerstandskraft; die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen“).
Der Direktor hat unter den Eltern erheben lassen, wie viele überlastet sind und ob die Lehrpersonen sich einbremsen müssen. Siebzig bis achtzig Prozent der Eltern meldeten zurück: Wir kommen zurecht. „Die große Herausforderung“, sagt Di Benedetto, „ist jetzt die Didaktisierung des Fernunterrichts.“
Im Schulsprengel von Ulrike Hofer helfen die Eltern sich manchmal gegenseitig, indem sie Unterlagen in den Postkasten schmeißen. Am Anfang bekamen die Kinder Lernpakete in analoger Form mit, jetzt gibt es sie auf der Website der einzelnen Schule – der Sprengel reicht hinein bis Pfunders. „Jetzt“, sagt sie, „müssen wir das Potenzial des digitalen Lernens ausschöpfen. Sie will jetzt auch neue Inhalte in den Unterricht einbauen: „Drei Monate lang vertiefen und verfestigen, das funktioniert nicht.“
Sigrun Falkensteiner und Landesrat Philipp Achammer trösten jetzt mit dem Satz: Die Schüler können in dieser Situation viel für das Leben lernen. „Die Krise“, sagt auch Werner Oberthaler, „ist eine Lebensschule.“ Oberthaler ist Direktor des Oberschulzentrums in Mals. „Wir haben schon große Erfahrung mit digitalem Unterricht, speziell in der Sportoberschule.“ Doch er sieht auch, wie die Sportler leiden: „Bewegung ist der Sinn ihres Lebens.“ Der eine oder andere ist schon einfach hinausgerannt, um zu trainieren, Oberthaler musste ihn zurückpfeifen.
Kann die Schule im Herbst weitermachen wie bisher? Vermutlich nicht. Eine Schutzmaske tragen und Distanz halten, wird das Gebot. Aber wie soll das bei kleineren Kindern funktionieren? Und wie gelingt Kommunikation, wenn man einem Menschen nichts ins Gesicht schauen kann, nicht sieht, ob er einen ernst nimmt oder auslacht?
Die Schüler werden womöglich ein paar Tage in der Woche in der Schule verbringen, an den anderen daheim arbeiten. Auch damit sie sich in den Bussen und Zügen nicht aneinander drängen. Sie werden dann lernen können, was die Schule immer einfordert: selbstständiges Lernen. Vielleicht werden sie dann, ihren Interessen gemäß, Inhalte freiwillig vertiefen. Wer das nicht kann, wird Hilfe brauchen – Lehrpersonen werden also auch Lernberater und Psychologen sein müssen. „Es wird“, sagt Petra Nock, „mehr finanzielle und personelle Ressourcen brauchen.“ 3,5 Milliarden Euro kalkulieren Experten für ganz Italien.
Simone Seitz sagt: „Man wird, wenn die Schule erst im Herbst wieder öffnet, noch viel stärker individuell arbeiten müssen, gerade in der Grundschule liegt das Entwicklungsalter weit auseinander. Man wird sich einmal mehr von der Illusion verabschieden müssen, dass alle das gleiche Wissen erwerben.“
Wo liegt die Chance?
Dass ein freieres Lernen entsteht, dass deutlich wird, wie künstlich Schule auch zeitlich strukturiert ist – Schüler werden dauernd aus der Arbeit gerissen. Vielleicht können so flexiblere zeitliche Strukturen entstehen, die vertiefendes Lernen erlaubt. Viele beobachten jetzt, dass Kinder und Jugendliche sich Zeit nehmen, sich mit Dingen beschäftigen, die sie wirklich interessieren.
Und, sagt Seitz, die Schüler merken jetzt, was ihnen wichtig ist an Schule.
Pauline, Mittelschülerin, 12 Jahre, sagt: „Es geht mir gut, ich komme zurecht. Aber lieber gehe ich in die Schule. Mir fehlen die Freunde und in der Schule versteht man alles besser.“
Klara Rieder, unterrichtet Deutsch und Geschichte an der WFO Bruneck
Klara Rieder sitzt gerade über der Korrektur von Schularbeiten, sie arbeitet auch in den Osterferien. Korrigieren, sagt sie, sei jetzt eine ihrer Hauptbeschäftigungen. Sie legt Wert darauf, zu arbeiten wie vorher: „Die Schüler wollen das auch so, dass ich ihre Arbeiten korrigiere.“
Wie alle ist sie kopfüber in den digitalen Unterricht gesprungen: „Wir hatten ja die Unterrichtsmaterialien meistens nur in Printform.“ Jetzt sucht sie im Internet nach geeigneten Materialien oder erstellt sie selber.
Die Arbeitsaufträge verschickt sie über das digitale Klassenbuch, legt einen Termin für die Abgabe der Aufgaben fest, dort bekommt sie diese auch wieder zurück. Rieder trägt die Noten ins Register ein, fügt eine Bemerkung hinzu, wenn ihr etwas aufgefallen ist, etwa wenn Aufgaben nahezu wortgleich erledigt wurden. Jetzt funktioniert es mit dem Register. „Am Anfang“, sagt sie, „war das System überlastet, die Lehrer haben sich nicht abgesprochen."
Im Moment, sagt sie, sei es eine permanente Fortbildung: „Gemütliche Zeiten habe ich nicht.“ Sie ist mit den Schülern per E-Mail in Kontakt, mit Google Meet hat sie es auch schon probiert. Es nahmen nur zwei aus der Klasse daran teil. Die anderen, beschied man ihr, würden vielleicht noch schlafen. Rieder, Autorin eines Buches über den Südtiroler Kommunisten Silvio Flor, sieht schnell, wer an die Grenzen kommt: Fernunterricht geht gut für die guten Schüler, „die lernschwachen werden einen Rückschritt machen, sie bekommen nicht die Unterstützung, die sie brauchen. Eine andere Gruppe, die sich hart tut, sind die, die ein bisschen bequem sind, die eine Struktur brauchen. (gm)
Simone Wasserer, unterrichtet drei Kinder daheim
Jetzt, nach einem Monat, hat sich alles eingependelt. Jetzt melden sich auch die Lehrerinnen, halten Kontakt, und die Pauline, meine Tochter in der ersten Mittelschule, hat zu Ostern einen sehr wertschätzenden Brief von ihrer Direktorin bekommen. Aber die Kinder würden lieber wieder in die Schule gehen, nur der Kleine genießt es, dass alle daheim sind. Mein Mann hat schon gefragt: Wer sagt ihm, dass er wieder in den Kindergarten muss?
Ich bin voll mit Unterrichten beschäftigt, das Grundschulkind musst du begleiten, das Mittelschulkind arbeitet viel am Computer – digital haben beide einen großen Sprung gemacht. Aber am Vormittag laufe ich dennoch von einem Kind zum anderen. Und ich frage mich manchmal: Haben die Kinder Lust, mit der Mama zu lernen, erkläre ich es ihnen richtig? Manche Sachen habe ich ja ganz anders gelernt.
Die Kinder müssen so schnell wie möglich wieder in die Schule.
Wir haben einen Betrieb, der im Moment geschlossen ist, ein Hotel, wir haben viel Platz, genug Computer. Was aber machen Familien, die nur wenig Platz haben und technisch schlecht ausgestattet sind? Und was machen wir, wenn wir das Hotel wieder öffnen können und die Kinder noch daheim sind? Und ich frage mich auch, was ist mit den schwächeren Kindern? Die Schere wird sich auftun. Es gibt zum Beispiel in der 1. Mittelschulklasse meiner Tochter ein Kind, das weder im Klassenchat noch bei der Videokonferenz dabei ist.
Die Situation zehrt an den Nerven. Wir hören immer nur, dass wir nächste Woche etwas hören werden, und die Woche darauf hören wir wieder das Gleiche. (Notiert von Georg Mair)
Irene Mur, Direktorin Schulsprengel Terlan
Am Anfang war da eine Schockstarre, wie alle waren wir unvorbereitet. Dann richtet man sich in der Situation ein. Und jetzt haben wir Lösungen gefunden, die praktikabel sind und wir haben Vertrauen geschöpft. Wir wissen jetzt, wir können auch digital arbeiten, wir sind anpassungsfähig.
Als Schule haben wir eine gesellschaftliche Funktion, nämlich Bildung zu garantieren, ein Grundrecht laut Verfassung. In der Krise offenbaren sich aber viel stärker die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und sozialen Hintergründe der Kinder. Als Schule versuchen wir, dem entgegenzuwirken.
Schwierig ist vor allem die Bewertung, hier sind einzelne Schüler benachteiligt. Man merkt, Chancengleichheit ist nicht mehr gegeben. Es gibt Eltern, die zu Hause im homeoffice sind, zwei, drei Kinder haben und nicht gleichzeitig arbeiten können. Es fehlen Geräte, es fehlen Internetanschlüsse, manche arbeiten nur mit dem Handy. Bei Kindern aus Migrantenfamilien gibt es sprachliche Probleme. Eine Alleinerziehende, die im Krankenhaus arbeitet, kann nicht spätabends noch den Satz des Pythagoras üben. Manche Eltern sind schlicht überfordert, andere fordern, dass mehr geliefert wird.
Uns ist es wichtig, dass wir jeden Schüler persönlich erreichen, einfach um zu zeigen: Wir sind da, wir lassen euch nicht allein. Da geht es gar nicht so sehr ums Lernen, da hat die Lehrperson eine soziale und auch psychologische Funktion. Es wird jetzt mehr denn je spürbar, wie wichtig Gemeinschaft für die Kinder ist: Wissen aufnehmen ist eines, aber zu wissen, dass ich von Menschen getragen werde, das geht nur in der Gruppe. (Notiert von Alexander van Gerven)
weitere Bilder
Bett neben Schreibtisch
Die Sache mit dem Fernunterricht: Videocalls, Selbstdisziplin und neues Schulglück. Mein Alltag im Fernunterricht. (von Anna Messner)
"Pipipipi pipipipi.“ Ich stöhne, drehe mich auf die Seite und versuche tastend meinen Wecker zum Schweigen zu bringen, den ich extra laut und durchdringend eingestellt habe, damit genau das nicht passiert. Es ist 6:30 Uhr und in meinem Kopf melden sich zwei Stimmen: „Du musst jetzt aufstehen, sonst schaffst du dein heutiges Pensum nicht. Du wirst um 10 Uhr geprüft.“ „Ach, jetzt stehst du seit fünf Wochen jeden Tag so früh auf, gönn’ es dir doch einmal, noch ein bisschen liegen zu bleiben.“
Am Ende bleibe ich zehn herrliche Minuten im warmen Bett, dann stehe ich auf und schaue mir meinen Kalender an. Er hängt an der Wand und ist so groß wie ein Plakat, damit ich genügend Platz habe, um Abgaben, Prüfungen, Tests, Schularbeiten und Videokonferenzen einzutragen. Die heutige Prüfung in Geschichte fällt mir ins Auge, darunter eine Abgabe in Grafik und für den nächsten Tag Italienisch, Physik und Philosophie.
Ich atme tief durch, versuche, den aufsteigenden Stress durch die Erinnerung an das schöne Bettgefühl zu dämpfen und setze mich an den Computer. Wie jeden Tag öffne ich als erstes die vielen Programme, über die der Fernunterricht läuft: Microsoft Teams, das digitale Register meiner Schule, Google Docs, Whatsapp und Email. Ich hoffe inständig, dass keine neuen Abgaben oder Lernzielkontrollen eingetragen wurden und registriere die Einladung zu einer Online-Kunstgeschichtestunde über Videocall. Außerdem habe ich mein Deutschplädoyer zurückbekommen und im Bereich „Chat“ haben meine Mitschülerinnen um eine Verschiebung der Philosophie-Abgabe gebeten. Dann beginne ich, den Stoff für die Prüfung zu wiederholen: Kolonialismus und Impe-
rialismus, Bismarcks Bündnissysteme, das Attentat von Sarajewo und die Julikrise.
Um Punkt 10 Uhr ploppt ein Fenster auf meinem Bildschirm auf. „Sie wurden zur Besprechung Geschichteprüfung eingeladen“. Wieder atme ich tief durch, klicke auf „Beitreten“ und schalte Kamera und Mikrofon ein. Auf dem Bildschirm taucht das Gesicht meiner Professorin auf, vor einem Bücherregal bei sich zu Hause. Wie immer fühlt es sich am Beginn eigenartig und noch immer ungewohnt an, meinem Computer Unterrichtsstoff zu erzählen, aber schon nach wenigen Minuten ist es, als säßen wir bei einer Vieraugenprüfung auf dem Schulgang. Erleichtert, diesen Punkt abhaken zu können, lege ich nach zwanzig Minuten auf und sehe sehnsuchtsvoll mein Buch an, das neben meinem Schreibtisch liegt. „Jetzt nicht“, denke ich „sonst bist du nachher wieder gestresst. Zuerst Grafik.“
Und so setzt sich mein Tag fort – auf einmal ist es Mittag, dann später Nachmittag und ich habe immer noch nicht alles für heute geschafft. Das ist ein Problem am Fernunterricht: Wenn man auch nur ein kleines bisschen perfektionistisch veranlagt ist und immer alles so gut wie möglich machen möchte, wird es schwierig. Denn man kann immer mehr machen. Ist man es allerdings nicht, tendiert man schnell dazu, im Bett liegen zu bleiben – sitzen bleiben kann man eh nicht dieses Jahr.
In den vergangenen Wochen hatte ich manchmal das Gefühl, viele Lehrpersonen vergessen, dass wir nicht nur Arbeitsaufträge in ihrem, sondern in elf weiteren Fächern bekommen. Es ist deshalb umso wichtiger, dass beide Seiten geduldig sind, sowohl Schülerinnen als auch Professorinnen. Sich neues Wissen anzueignen ist wichtig, auch, um die Tage zu füllen, aber Ruhe angesichts dieser ungewohnten
Situation ebenso.
Und neben dieser neuen Art von Schulstress gibt auch neues Schulglück: Das Gefühl, sich Stoff erfolgreich durch viel Disziplin selbst beigebracht zu haben, Videokonferenzen mit Lehrpersonen, an deren Ende alle melancholisch werden und nicht auflegen möchten, Sprachnachrichten an die Italienischprofessorin, in denen man einfach erzählen soll, wie es einem geht und Momente, in denen man richtig ins Lernen eintauchen kann, weil keine Schulglocke läutet.
Weitere Artikel
-

-
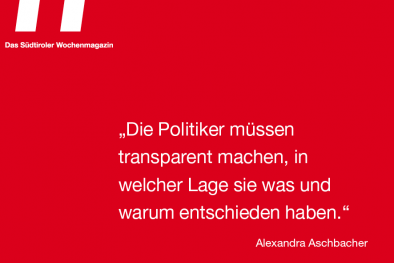
Navigieren auf Sicht
Eine Gebrauchsanleitung für den Umgang mit Corona gibt es leider nicht. Also tastet sich jeder irgendwie durch die Krise. Auch die Politiker.
-

Der Bauer bringt’s
Geschlossene Bauernmärkte, Gastronomie und Tourismus im Stillstand: Wie die Bauern auf ihrer Ware sitzen bleiben – und nach neuen Vertriebswegen suchen.


























Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.