Kultur online: (gm) Im Treibhaus in Innsbruck spielen das Kabarett und der Jazz. Jetzt ist der Laden zu. Dafür gibt es ...
Politik
Kühlen Kopf bewahren
Aus ff 14 vom Donnerstag, den 02. April 2020

Das Gesundheitssystem steht vor seiner härtesten Probe. Primar Reinhold Perkmann über den Krankenhausalltag in der Ausnahmesituation.
Reinhold Perkmann kommt gerade aus einer der vielen Corona--Besprechungen, als wir ihn telefonisch erreichen. Jeder der Beteiligten saß mit Schutzmaske da, im nötigen Sicherheitsabstand. „Auch wir halten uns an die Regeln“, sagt er. „Jeder von uns, der ausfällt, ist einer weniger in einer personell eh schon prekären
Situation.“ Perkmann ist Primar der Gefäß- und Thoraxchirurgie am -Landeskrankenhaus Bozen sowie Vorsitzender der Primargewerkschaft Anpo. Von seinen Einsätzen in Afghanistan weiß er, was es bedeutet, sich als Arzt entscheiden zu müssen: Wer darf überleben – und wer nicht?
ff: Herr Perkmann, wie ist dramatisch ist aktuell die Situation am Krankenhaus Bozen?
Reinhold Perkmann: Es ist für alle Beteiligten eine Ausnahmesituation, die nun einmal auch Ausnahmemaßnahmen erfordert. Unser System ist für so eine Epidemie nicht gerüstet, und so ist vieles – nicht im schlechten Sinne – eine Improvisation.
Das heißt konkret?
Es ist wichtig, eine Struktur hinein zu bekommen, nicht nur hinsichtlich der räumlichen und personellen Situation, sondern auch von den Abläufen her. Es gibt natürlich immer wieder bestimmte Engpässe, einmal fehlen die Reagenzien, dann die Schutzausrüstung – letztere ist jetzt zum Glück wieder da.
Im Krankenhaus stehen an allen Ecken Desinfektionsmittelspender. Reicht der Vorrat? Desinfizieren Sie Ihre Hände jetzt noch öfter als sonst?
Ja, auf alle Fälle. Für uns ist das zwar Normalität, ein Automatismus, vor allem für uns Chirurgen. Aber jetzt achtet man noch einmal mehr darauf. Engpässe gibt es keine. Vergangene Woche gab es eine prekäre Situation bei den Schutzmasken und Schutzmänteln. Das Material wurde entsprechend
sparsam verwendet – man wusste ja nicht, ob es Nachschub geben würde.
Würden Sie die Situation als dramatisch bezeichnen?
Dramatisch ist ein dehnbarer Begriff. Es kommt immer auf den Blickwinkel an, aus dem man das Geschehen betrachtet. Aber ja, es ist dramatisch. Für die Covid-Patienten, für die Menschen, die sich an die Ausgangssperre halten müssen, für all die anderen Patienten, die beispielsweise nicht mehr so viel besucht und auch nicht mehr so stark persönlich betreut werden können. All das trägt zu einem subjektiven Gefühl der Dramatik bei. Es ist aber keine Dramatik im Sinne von Chaos. Es ist eine dramatische Situation, die eine Ausnahme darstellt in unserer Welt, wie wir sie bisher kannten.
Jeder hat die Bilder vom Krankenhaus in Bergamo vor Augen: Ärzte und Pfleger, die am Rande des körperlichen Zusammenbruchs arbeiten, Patienten, die in den Gängen liegen.
Ich werde zurzeit von vielen deutschen Kollegen kontaktiert, die alle sehr besorgt sind, eben weil sie sehen, was in der Lombardei los ist. Wir hier sind aber weit davon entfernt. Vielleicht, weil wir nicht so viele Patienten haben, vielleicht, weil wir etwas mehr Vorlaufzeit hatten, uns zu organisieren. Die Lombardei hat das Virus ja ganz plötzlich und mit voller Wucht erwischt.
Planbare Operationen werden erst mal verschoben. Betrifft das alle Bereiche?
Viele Abteilungen haben schon vor der offiziellen Aufforderung seitens des Betriebes damit begonnen, planbare Operationen zu verschieben. Man muss unterscheiden zwischen längerfristig und kurzfristig aufschiebbaren Operationen, und sich von Patient zu Patient fragen: Wem kann man was zumuten? Mittlerweile ist das OP-Programm aller chirurgischen Fächer auf ein Minimum reduziert worden, auch weil die Anästhesisten fehlen, die jetzt alle zum größten Teil für die Covid-Patienten abgezogen wurden. Bis vor einigen Wochen war die Situation noch prekär: Wir mussten ständig darauf hinweisen, dass wir beispielsweise Patienten mit Tumoren in den seltensten Fällen aufschieben können.
Kann es passieren, dass Stationen – zumindest vorübergehend – geschlossen werden?
Die Coronapatienten stehen im Moment natürlich im Fokus. Trotzdem machen die anderen Erkrankungen ja keine Pause in dieser Zeit. Gerade in unserem Fall, wo wir auch viele Patienten mit Lungentumor haben, können wir nicht ewig warten. Also operieren wir weiter – sobald Raum und Anästhesist verfügbar sind. Ansonsten wird zurzeit viel Personal umgeschichtet, Ärzte und Pflegekräfte werden für die Covid-Stationen abgezogen. Drei unserer Ärzte arbeiten jetzt dort, auch ein Teil unserer Pflegerinnen. Es gibt verschiedene Schweregrade dieser Erkrankung, im letzten Stadium, wo der Patient künstlich beatmet werden muss, braucht es Anästhesisten, Intensivmediziner. Aber in den Stadien davor können auch alle anderen Fachärzte – wir sind schließlich alle Mediziner – mitarbeiten und mithelfen.
Haben die anderen Patienten Verständnis für diese Situation?
Die meisten sind sehr verständnisvoll, einige auch recht froh, wenn man ihnen das zusätzliche Risiko erklärt. Ein Krankenhaus ist immer eine höhere Gefahrenquelle für Infektionen. Gerade unter diesem Gesichtspunkt müssen wir gut abwägen, welche Operation Sinn macht, speziell in unserem Fall, wenn man Lungenpatienten operiert. Aber auch ein Patient mit schweren Durchblutungsstörungen hat das Recht, entsprechend behandelt zu werden und das wird er auch. Laut einem Rundschreiben des Betriebes haben die Leiter der Abteilungen die Verantwortung dafür, Operationen zu verschieben oder nicht. Wenn wir die Möglichkeiten und die Ressourcen haben, operieren wir auch. Wenn das morgen aufgrund einer chaotischen Situation nicht mehr geht, können wir dem Patienten auch nichts mehr vorschlagen. Aber zum Glück sind wir jetzt nicht in dieser Situation.
In den überlasteten Krankenhäusern in Spanien oder in der Lombardei zwingt das Virus die Ärzte zur Triage, also zur Aussonderung meist alter Schwerstkranker. Gibt es eine Handlungsanweisung für diese Situation?
Die Entscheidung liegt dann bei der Ärzteschaft, die an vorderster Front arbeitet. Sollten die Ressourcen in Notaufnahmen und Intensivstationen irgendwann nicht mehr ausreichen, entscheiden sie, welche Patienten behandelt werden sollen und welche nicht. Der Fachbegriff dafür lautet Triage. Ärzte, die diesen Begriff nur von der
Theorie her kennen, werden vor große Herausforderungen gestellt, vor medizinische, vor allem aber vor menschlich-ethische.
Sie waren mehrmals in Afghanistan, haben als Arzt erlebt, was Krieg und Traige bedeuten. Wie sehen Sie das, was zurzeit bei uns hier passiert?
Man kann die beiden Situationen nicht vergleichen. Aber ich habe natürlich gelernt zu entscheiden: Dieser Patient wird nicht mehr behandelt, weil er keine Überlebenschance hat, dafür behandeln wir diesen anderen. Das ist hart und brutal. Aber das Krankenhaus in Afghanistan war genau auf diese Situationen ausgerichtet und strukturiert. Aber klar, die menschliche Seite der Entscheidung ist immer dieselbe.
Wie sind Sie persönlich damit umgegangen?
Man darf kein schlechtes Gewissen haben, wenn man einen Patienten nicht so behandeln kann, wie man das eigentlich möchte. Es sind Entscheidungen, die man sehr nüchtern, ja, frei von jeden Emotionen treffen muss.
Viele Entscheidungsträger ringen zurzeit um das richtige Vokabular, viele üben sich in Kriegsrhetorik. Der Kampf gegen das Virus sei ein Krieg, heißt es oft. Einverstanden?
Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun und befinden uns in einer schweren Krise. Eine Krise braucht Haltung, Respekt und Zuversicht. Sie braucht keine Kriegsrhetorik.
Hat man als Arzt Angst, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren?
Ich neige zu einem gesunden Fatalismus. Aber ich animiere mich selber und auch alle anderen dazu, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Und hoffe, dass es so wenig Menschen wie möglich trifft. Es ist zurzeit ja so, dass jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, zunächst getestet wird. Solange wir das Ergebnis nicht haben, behandeln wir ihn so, als ob er positiv wäre. Das heißt, wir gehen mit voller Schutzausrüstung zu ihm. Wir hatten auf unserer Station auch schon Patienten, die zweimal negativ getestet waren und erst das dritte Mal positiv.
Und wie ist zurzeit die Stimmung innerhalb der Ärzteschaft?
Es gibt Kollegen, die sehr nüchtern und unaufgeregt agieren, jedoch mit dem entsprechenden Respekt. Bei einigen Kollegen spürt man, dass sie übervorsichtig sind. Niemand von uns weiß, was noch alles auf uns zukommen wird. Trotzdem nützt es niemandem, wenn jemand von uns panisch wird. In solchen Situationen ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn der Leader die Nerven verliert, dann ist es vorbei.
Wie sähe das Worst-Case-Szenario aus?
Da brauchen wir nur nach Bergamo schauen. Das wäre für mich das Chaos. Aber soweit wird es bei uns nicht kommen.
Und wenn doch: Wie gut ist unser Gesundheitssystem gerüstet?
Man kann über die Vergangenheit sagen, was man will, da hat bei weitem nicht immer alles gepasst. Aber heute, in dieser Situation, muss ich sagen, dass wir insgesamt nicht schlecht aufgestellt sind. Was uns zugute kommt, sind die sieben Krankenhäuser mit den wichtigsten Abteilungen auch in der Peripherie. So kann die Last auf alle Häuser verteilt werden, können Patienten ausgelagert werden. Ob das auch eine Rechtfertigung aller Strukturen für die Zukunft ist, ist aber eine andere Frage.
Sie sind ja nicht unbedingt der Bedenkenträger, aber gibt es etwas, das Ihnen Sorgen macht?
Was mir zu denken gibt, das ist die Zeit danach. Was wird sich dann in unserer Gesellschaft abspielen? Was bleibt von alledem übrig? Jetzt wird alles unter dem Deckmantel der Ausnahmesituation und Notwendigkeit entschieden. Ob wir dann wieder so schnell zum Normalzustand zurückkommen, ist fraglich. Andererseits sieht man jetzt auch, wie die Menschen zusammenstehen und sich gegenseitig stützen. Das hat ja auch schon Albert Camus in „Die Pest“ beschrieben: In Extremsituationen werden die guten Menschen noch besser und die schlechten noch schlechter.
Was wird diese Krise längerfristig mit unserer Gesellschaft machen?
Ich glaube, wir müssen uns insgesamt darum bemühen, das Niveau unseres demokratischen Gefüges zu halten. Ich habe so meine Zweifel, ob wir dieses noch einmal erreichen werden, wenn man beobachtet, wie zurzeit regiert wird. Was das Gesundheitssystem betrifft: Wir werden aus dieser Krise sicherlich viele Lehren ziehen müssen. In Afghanistan haben wir beispielsweise nach jedem Massenansturm von Verletzten darüber diskutiert, was gut gelaufen ist, was verbessert werden und anders geplant werden muss. Wenn wir uns das Ende von „Die Pest“ anschauen: Am Ende ist dieser Feind zwar besiegt, die Bewohner von Oran können
aufatmen – für wie lange, bleibt aber offen.
Es wird nicht die letzte Epidemie sein.
Ich will nicht wie Kassandra in der griechischen Mythologie ungehörte Warnungen aussprechen, aber die spanische Grippe machte 1918 zweimal die Runde um den Erdball. Wollen wir nicht hoffen, dass es soweit kommt.
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

„Ihr könnt euch wehren!“
Gewalt gegen Frauen: (ml) Italienweit werden Frauen dazu aufgerufen, auch in der aktuellen Ausnahmesituation Gewalt nicht ...
-

Kopf und Corona
In diesen Tagen frage ich mich oft, welche Fragen man noch stellen darf. Das Virus bringt uns auch geistig in den Ausnahmezustand.
















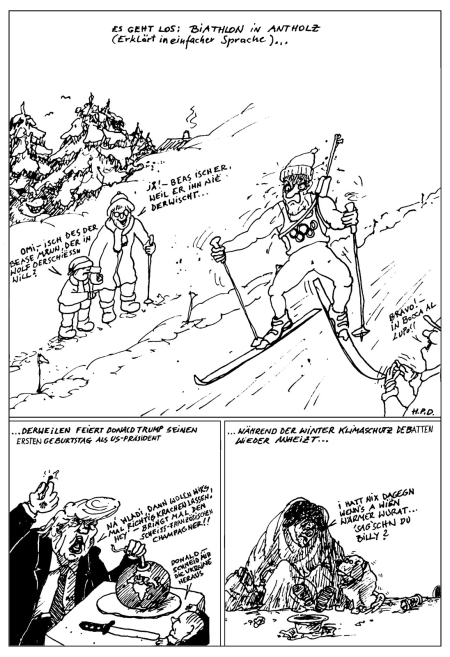




Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.