Gustav Thöni: (gm) Ist das Gespräch zwischen Aldo Cazzullo, einer der Edelfedern des Corriere della Sera, und Gustav Thöni ...
Politik
„Da tickt eine Bombe“
Aus ff 06 vom Donnerstag, den 11. Februar 2021

Nicht-Covid-19-Patienten können nicht mehr angemessen versorgt werden. Ärzte schildern, wie es in Südtirols Krankenhäusern aussieht – und was sie befürchten.
Stefan Mair hat Nachtdienst auf der Covid-Intensivstation. „In der Hölle“, wie er es nennt. Alle, sagt er, seien am Anschlag. „Wir hier drinnen kämpfen, und draußen machen alle, was sie wollen.“ Der erfahrene Intensivmediziner, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ärgert sich über die Disziplinlosigkeit vieler Südtiroler. Er ärgert sich auch, wenn er von freien Bettenkapazitäten als Messlatte für die Pandemiebewältigung hört.
„Die Situation“, sagt er Anfang Februar, „ist nicht unter Kontrolle. Alle sind mit den Betten an der Grenze.“ Wenn sich das Virus weiter so verbreitet und täglich zwei bis drei Intensiv-patienten dazukommen, werde man schon bald alle anderen Leistungen und Operationen „komplett stoppen“ müssen.
Was oft vergessen wird: Es gibt nicht nur Covid-19. Viele Abteilungen schaffen es nicht mehr, die Nicht-Covid-Patienten so zu behandeln, wie es sein sollte. Ende Januar hatte sich der Bozner Chefarzt Reinhold Perkmann mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt: Man sei an einer Grenze angelangt, die man als Mediziner nicht mehr akzeptieren könne.
Reinhold Perkmann, 59, Primar der Gefäß- und Thoraxchirurgie am Krankenhaus Bozen, Vorsitzender der Chefärzte-Gewerkschaft ANPO
„Bis vor Corona haben wir, alle chirurgischen Disziplinen gemeinsam, einmal in der Woche das OP-Programm besprochen. Dieses Treffen findet seit einem Jahr nicht mehr statt. Allein unsere Abteilung hat nur noch an zwei Tagen einen Operationssaal zur Verfügung. Zum Vergleich: Vor Corona standen unserer Abteilung 6 OP-Tage zur Verfügung. Deshalb schaffen wir auch nur noch 30 Prozent unserer bisherigen Tätigkeit. Von unseren 28 Betten sind 13 übrig geblieben. Die fehlenden Pflegekräfte, die zu einem großen Teil für den Covid-Bereich abgezogen wurden, limitieren unsere Tätigkeit im OP ebenso wie auf der Station. Jeden Morgen müssen wir entscheiden, welche Patienten innerhalb der nächsten zwei, drei Tage operiert werden müssen. Notfälle können wir zwar versorgen, aber viele andere Patienten, die wir auch innerhalb gewisser zeitlicher Vorgaben operieren sollten, müssen warten. Es ist ein tägliches Improvisieren, und noch mehr als sonst müssen wir Ad-hoc-Entscheidungen treffen. Wir arbeiten in einer großen Unsicherheit. Das Erschreckende ist, dass wir uns an dieses neue Arbeiten gewöhnt haben. Jeder tut in dieser unmöglichen Zeit sein Möglichstes.
Diese Krise zeigt in aller Härte vor allem den Mangel an Pflegekräften und Ärzten auf. Und sie zeigt, dass wir immer noch weit davon entfernt sind, ein einziger, starker Sanitätsbetrieb zu sein. Jedes Krankenhaus, jeder Bezirk kocht sein eigenes Süppchen. Viele in der Peripherie, aber auch an verantwortlichen Stellen, scheinen vergessen zu haben, dass das Landeskrankenhaus einen anderen, zusätzlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen hat, auch in einer Pandemie. Abteilungen, die es landesweit nur einmal gibt, nämlich in Bozen, dürfen nicht ausgehungert werden. Deshalb mein Vorschlag, einen Teil der Covid-19-Patienten auf die peripheren Häuser aufzuteilen und nicht nur die intensivpflichtigen Patienten.
In meinen Augen der einzig machbare Plan. Nachdem er über Wochen kategorisch abgelehnt wurde, gibt es jetzt grünes Licht dafür. Allerdings erst nach massivem Druck von Öffentlichkeit und Gewerkschaften. Das ist traurig. Eigentlich müsste so ein Plan von Anfang an Teil einer Strategie sein. Aber eine Strategie ist immer noch nicht erkennbar.“
Selbst nach einem Jahr Pandemie meiden viele Patienten den Besuch beim Arzt. Manche schieben selbst nötige Eingriffe im Krankenhaus auf. Oft aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Während in Teilen Deutschlands bereits im vergangenen Sommer versucht wurde, mit Aufklärungskampagnen diesem Trend gegenzusteuern, passiert in Südtirol nichts dergleichen. Es brauche hier „Appelle an die Bevölkerung“, sagt etwa der Geriatrie--Primar Christian Wenter, „dass niemand eine Erkrankung zu Hause aussitzen soll.“
Christian Wenter, 61, Primar der -Geriatrie am Krankenhaus Meran
„Seit einem knappen Jahr bin ich ein Vollzeit-Covid-19-Arzt. So wie auch 9 meiner Ärztinnen und drei Ärzte. Seit zwölf Monaten gibt es in Südtirols Krankenhäusern keine stationäre Reha mehr und keine Geriatrie, seit Kurzem auch kaum eine stationäre Neurologie. Das ist dramatisch. Da tun sich gewaltige Lücken in der Versorgungskette auf. Wir hier im Haus haben kein Verständnis mehr dafür, dass von offizieller Seite nicht sehr viel klarer erklärt wird, wie die Situation wirklich ist.
Schon seit November hätte es sehr viel drastischere Maßnahmen gebraucht. Kein Wunder, dass sich die Situation jetzt wieder zuspitzt. Seit einigen Tagen gibt es einen extremen Anstieg der Fallzahlen; die Betten der Covid-Normalstationen sind mehr oder weniger im ganzen Land belegt. Seit gestern (Donnerstag, Anm.d.Red.) machen wir hier im Haus nur noch Notfallbehandlung, es gibt keine programmierten chirurgischen Eingriffe mehr, zu viel Personal wird jetzt für Covid gebraucht. Dabei reichen die Personalressourcen schon lange nicht mehr. Wir sind mit unserer Situation nicht weit weg von Portugal, dem derzeitigen -Corona-Brennpunkt in Europa. Während da ganz Europa zu Hilfe eilt, heißt es in Südtirol, wir hätten alles unter Kontrolle. Aber wir haben keine Kontrolle mehr.
Wir nähern uns der Anzahl von 900 Todesfällen. Die allermeisten Patienten sterben nicht mit oder an Corona, sondern direkt an den schweren Komplikationen von Covid-19. Dieses Thema schieben wir als Gesellschaft weit von uns weg. Die Situation ist sehr besorgniserregend. Die Folgeschäden bei den Covid-19- und den Nicht-Covid-Patienten werden groß sein. Es gibt bereits jetzt Simulationen darüber, wie viele Lebensjahre durch Covid-19 verloren gehen. Ein großes Problem ist, dass immer noch weniger Menschen ins Krankenhaus gehen. Viele kommen mit ihren Beschwerden zu spät, und dann mit den entsprechenden Komplikationen. Sehr viele verzichten auf Kontrolltermine.
Trotz aller Dramatik gibt es auch positive Entwicklungen: Wir haben viel gelernt, organisatorisch und medizinisch. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir neue Technologien und Strategien implementieren. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit hat einen Schub bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt.“
Eine jüngst durchgeführte Studie in 20 Ländern, darunter auch Italien, zeigt auf, dass die Gesundheitsleistungen seit Beginn der Pandemie um 37 Prozent zurückgegangen sind. Die ambulanten Visiten sogar um 42 Prozent. Überall wird Pflegepersonal für die Covid-Bereiche abgezogen. Neuro-chirurg Andreas Schwarz sagt, man befinde sich hinsichtlich der Versorgung von Nicht-Covid-19-Patienten „in einer tiefroten Zone“.
Andreas Schwarz, 61, Primar der Neuro-chirurgie am Krankenhaus Bozen
„Unsere Leistungen als Neurochirurgie sind seit circa einem Jahr um die Hälfte reduziert. Wir haben 20 neurochirurgische Betten für das ganze Land; in dieser Pandemie haben wir noch 12, und die sind ständig belegt. Normalerweise gehen in einem Jahr zwischen 1.200 und 1.500 Patienten durch diese Betten. Manche Betten werden an einem Tag von drei verschiedenen Patienten gebraucht. Das ist nur möglich, weil wir die Patienten immer verlegen konnten. Seit einem Jahr aber ist das unmöglich: Abgesehen vom Krankenhaus Sterzing gibt es keine offene Reha-Station. Die Betten in den Privatkliniken sind mit Covid-19-Patienten ausgelastet. Auch die peripheren Häuser haben kaum Kapazitäten, einen unserer Patienten zu übernehmen. Die Situation ist dramatisch. Viel dramatischer, als von offizieller Seite angegeben wird. Leider hat unsere Obrigkeit bislang keine Antwort auf diese schwierige Situation.
Was viele nicht sehen wollen: Auch unsere neurochirurgischen Patienten sind sehr pflegeintensiv. Patienten mit operierten Tumoren oder Aneurysmen müssten von Rechts wegen für 24 Stunden auf die Intensivstation. Weil das jetzt nicht geht, liegen sie bei uns auf der Station. Hier braucht es eine lückenlose Überwachung und Versorgung, das sind extrem schwierige Situationen. Viele Pflegekräfte sind erschöpft, dürfen weder Urlaub noch Zeitausgleich nehmen. Einige meiner Pflegekräfte, die für den Covid-Bereich abgezogen wurden, sagen: Wenn es so weitergeht, kündigen sie. Viele wurden per Dienstanweisung auf die Covid-Station verlegt. Das ist eine Bombe, die früher oder später explodieren wird.
Als Primar lernt man, diese Ausnahmesituation zu managen, ohne sich allzu sehr emotional hineinziehen zu lassen. Aber klar, die Situation berührt einen auch persönlich. Man ist ungeduldig, frustriert. Auch weil man sieht, dass wir so schnell nicht aus dieser Situation herauskommen werden.“
Corona bringt das Gesundheitssystem an den Anschlag. Ärzte und Pfleger müssen ständig improvisieren, die Dinge selbst in die Hand nehmen. Der Internist Othmar Bernhart sagt: „Wir haben uns im Grunde seit Beginn der Pandemie selbst organisiert.“
Othmar Bernhart, 58, Primar der Inneren Medizin am Krankenhaus Brixen
„Wenn alle an einem Strang ziehen, kann man als Krankenhaus auch in so einer Ausnahmesituation sehr viel machen. Wir haben eine Covid-Station mit 18 und eine neue Covid-Station mit 14 Betten. Diese haben wir im neu erbauten Krankenhausflügel eingerichtet. Ebenso verfügen wir über eine medizinische Subintensiv mit 6 Betten, die bereits zweimal zu einer Vollzeit-Covid-Station umgebaut wurde. Die Intensivstation ist provisorisch in den neuen Flügel eingezogen, weil sie dort zu den fixen 6 Betten weitere 2 dazustellen kann. Das alles ist ein riesengroßer Aufwand.
Auf der Medizin hatten wir das Glück, einige Ärzte und Pfleger mit Covid-19-Verträgen anstellen zu können. So gelingt es uns, die normale Station als auch die Ambulanz am Laufen zu halten. Wir versuchen, die chronischen Patienten, so gut es geht, weiter zu betreuen. Die Screeningprogramme für Darmtumore führen wir weiterhin durch. Dazu müssen wir als Medizin-Abteilung den gesamten Covid-Bereich stemmen. Wenn alle 32 Betten belegt sind, ist das eine extrem belastende Situation. Pflegebedarf und -aufwand für Covid-19-Patienten ist riesig. Für einen 33. Patienten haben wir keinen Platz und auch keine Ressourcen. Insgesamt ist das Krankenhaus wahnsinnig eingeschränkt in seiner Arbeit. Chirurgie und Urologie sind in einer einzigen Abteilung zusammengepfercht. Auch die Teams der Traumatologie und HNO sind zusammengeschrumpft. Die operative Tätigkeit ist immens eingeschränkt: Chirurgen und Urologen schieben jeweils an die 200 Operationen vor sich her. Wären jetzt auch die Skigebiete offen – die Trauma könnte diese Unfälle unmöglich zusätzlich stemmen.
Was seit einem Jahr total falsch läuft, ist die Kommunikation, nach innen im Sanitätsbetrieb, nach außen zur Bevölkerung. Es wäre höchst an der Zeit, den Menschen klar aufzuzeigen: Wenn die Covid-19-Fallzahlen noch weiter ansteigen, muss die nicht-Covid-19-Betreuung noch mehr zurückgefahren werden. Das zieht einen Kollateralschaden nach sich. Ich bedaure es, dass es der Sanitätsbetrieb nicht geschafft hat, jene an einen Tisch zu bringen, die die Hauptlast in dieser Corona-Geschichte tragen: Internisten, Anästhesisten, Geriater, Infektiologen. Viele praktische und unmittelbare Fragen hätte man so oft anders klären können.“
Die Ärzte, die hier zu Wort kommen, neigen nicht zu Alarmismus. Doch die steigenden Fallzahlen und der Mangel an Personal bereiten ihnen Sorge. Bis man wieder im „Normalbetrieb“ arbeiten könne, dauere sehr viele Monate. Der Kampf darum, die Krankenhäuser funktionsfähig zu halten, bleibt ein Langstreckenrennen. „Vor allem hinsichtlich der Nicht-Covid-Abteilungen brauchen wir jetzt Lösungen“, sagt Martin Steinkasserer. „Sonst wird das ganze System auf Dauer nicht mehr funktionieren.“
Martin Steinkasserer, 56, Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen
„In meiner bisherigen medizinischen Laufbahn musste ich nie Patienten selektionieren. Es gab immer Platz und Ressourcen für alle. Seit einem knappen Jahr aber bewegen wir uns als Gesundheitssystem gefährlich nah an der Klippe entlang. Wir kommen an unsere Grenzen. Die Wartelisten für Operationen werden länger, wir müssen Prioritätslisten für unsere Patientinnen erstellen. Es fehlt das Personal. Es ist eine extrem belastende Situation – für das Covid-Personal, aber auch für die Nicht-Covid-Abteilungen.
Unsere OP-Möglichkeiten sind reduziert: dringende sowie alle onkologische Operationen werden natürlich durchgeführt. Viele andere Patientinnen müssen deutlich länger warten als noch vor der Pandemie, so etwa Frauen, die an Endometriose erkrankt sind. Die ambulante Tätigkeit versuchen wir fortzuführen, ebenso die onkologischen Vorsorgeuntersuchungen. Wir sollten uns jetzt schon überlegen, wie wir dann, wenn wir aus dem Gröbsten raus sind, die vielen überhängenden Operationen abarbeiten können. Möglich wären Zusatzleistungen an den Wochenenden oder in der Nacht, gekoppelt mit finanziellen Anreizen.
Wir werden innovativ sein müssen. Ich habe in diesem Jahr erlebt, dass die alten Lösungsansätze nicht mehr funk-tionieren. Das Ganze ist eine wahnsinnige Herausforderung – die vielen von uns auch psychisch zusetzt. Man ist mit dem Kopf immer bei der Arbeit und seinen Patientinnen, will die bestmögliche Versorgung gewährleisten. Meine Verantwortung als Primar spüre ich heute sehr viel mehr als vor der Pandemie. Man muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, viel alleine organisieren. Ich kann ja nicht nur in meinem Büro sitzen und hoffen, dass das Ganze irgendwann vorbeigeht.
Als betroffener Spieler kommt man mit dem Motto ‚Augen zu und durch‘ nicht weiter.“
Wie geht es weiter? Vergangene Woche erreichte die Chefärztinnen und -ärzte ein Schreiben der Direktion des Bozner Krankenhauses. In Absprache mit der Generaldirektion, so heißt es darin, müsse das Landeskrankenhaus künftig nicht mehr als 102 Covid-Patienten versorgen. Zurzeit behandle man dort 120. Künftig würden die überschüssigen Covid-Patienten auf die anderen Gesundheitsbezirke verteilt. Am Ende heißt es: Dieses Vorgehen sei nur dann gültig, wenn sich die epidemiologische Situation nicht verschlechtere. „Wir stecken hier in einem Flaschenhals“, sagt der Urologie-Chefarzt am Bozner Krankenhaus.
Armin Pycha, 59, Primar der Urologie am Krankenhaus Bozen
„Was man sicher sagen kann, ist, dass wir Patienten, die keine Tumorerkrankung haben, nicht mehr gemäß den Leitlinien versorgen können. Den Covid-Patienten wird alles andere untergeordnet. In der ersten Welle wurde die Tätigkeit unserer Abteilung auf 5 Prozent heruntergefahren, über den Sommer hinweg haben wir 40 Prozent geschafft, jetzt sind wir bei 20 Prozent unserer präcovid-operativen Tätigkeit angelangt. Wir haben 30 Betten – in Normalzeiten war diese Anzahl schon sehr knapp. Heute bespielen wir 12! Aber alle anderen Erkrankungen hören ja nicht auf, nur weil wir eine Covid-Pandemie haben. Ein Patient etwa, der mit Harnverhalt aufgrund einer Prostatavergrößerung zu uns kam, wurde bis vor Corona innerhalb zwei, spätestens drei Wochen operiert. Allein diese Patienten können wir seit Monaten nicht operieren. Sie müssen viele Wochen mit einem Katheter leben, das ist doch keine Lebensqualität! Je länger so ein Katheter getragen wird, desto höher ist das Risiko einer Harnwegsinfektion. Das setzt eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang.
Welche Szenarien wurden für bestimmte Infektionszahlen entwickelt? Gibt es einen Stufen-Plan, wie man mit der Versorgung operativer Patienten umgeht? Vielleicht gibt es all das ja. Uns aber wurde derlei nie präsentiert. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir dieses Virus loswerden. Wir müssen mit Corona leben. Also müssen wir eine Koexistenz aufbauen zwischen Corona- und nicht-Corona-Patienten. Es gibt jetzt schon Personen, die uns einen Prozess androhen, weil sie oder ihre Angehörigen nicht zeitgerecht operiert werden. Das Verständnis und die Empathie für die derzeitige Notsituation nehmen rapide ab. Für unsere Abteilung gelten die zwei Grundsätze: ‚Das Machbare wird getan‘. Und: ‚Alles sofort‘.
Was wir seit Monaten schon vermissen, ist eine abgestufte Synchronisierung von Peripherie und Landeskrankenhaus, eine Ressourcenaufteilung nach Notwendigkeiten. Alle arbeiten über dem Limit. Viele sind bereit, das System auszureizen, um das Möglichste zu machen. Vom Menschlichen her sind das wertvolle Erfahrungen, für die ich dankbar bin.“
weitere Bilder
Weitere Artikel
-

-

Magere Staatshilfen
In der jüngsten Ausgabe hat ff berichtet, wie der Staat heimische Betriebe mit Covid-Hilfen stützt. Dabei haben sich einige Zeilen verschoben – hier nun die korrekte Tabelle.
-

Fataler Stillstand
An den meisten Universitäten findet der Großteil des Unterrichts online statt – das setzt vielen Studierenden psychisch zu. Sie hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.



















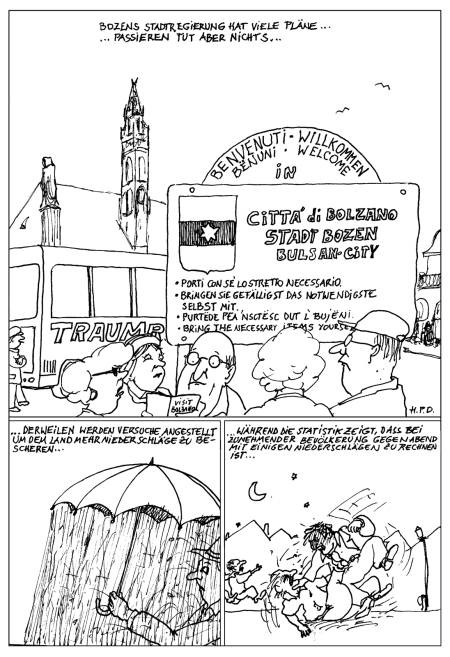




Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.