Erfolgreiche Familienbetriebe gibt es zuhauf, aber nur wenige schaffen es, über Generationen zu bestehen. Wer sie sind – ihr Aufstieg, ihre Bedeutung, ihre Zukunft.
Politik
Kraftprobe
Aus ff 09 vom Donnerstag, den 04. März 2021
Die Pandemie verlangt Hausärztinnen und Hausärzten alles ab – und das schon seit Monaten. Der Frust und die Verzweiflung sind mittlerweile groß.
Vor knapp drei Wochen wandten sich 108 Hausärzte im Land in einem offenen Brief an die Verantwortlichen in Politik und Sanitätsbetrieb. Sie forderten darin bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Kommunikation und etwas mehr Wertschätzung. „Noch größer als die Angst vor einer Ansteckung“, heißt es im Brief, „ist die anhaltende Belastung durch das täglich wachsende Arbeitspensum, das von vielen kaum mehr zu bewältigen ist.“ Der Brief war ein dramatischer Hilferuf.
Seitdem knirscht es gewaltig zwischen der Sanitätsspitze und der Basismedizin. Die einen sind verärgert, sie empfinden den Brief als Affront. Die anderen sind enttäuscht und fühlen sich nicht ernst genommen – wieder einmal. Obwohl viele Haus-ärzte zutiefst besorgt sind, will sich damit niemand zitieren lassen. Viele Ärzte bitten ff um Anonymisierung. Andere vertrösten auf einen späteren Zeitpunkt. Der offene Brief hat eines gezeigt: Kritik am Sanitätsbetrieb ist heikel. Zu groß ist offenbar auch die Angst, weitere Verhandlungen und Gespräche zu gefährden.
Klartext sprechen viele Südtiroler Hausärzte derzeit also nur, wenn kein Aufnahmegerät und keine Kamera in der Nähe ist. Trotzdem wollten wir hören, was sie zu sagen haben. Denn Hausarztpraxen sind für viele Menschen die ersten und wohl wichtigsten Anlaufstellen. Das gilt besonders in Zeiten der Pandemie. Die Praxis, die einem vertraut ist, deren Nummer man gespeichert hat, ist doch am schnellsten zu erreichen. Bricht die basismedizinische Versorgung zusammen, bricht die gesamte Gesundheitsversorgung zusammen.
Das Bild, das sich aus verschiedenen Gesprächen mit Haus-ärzten zusammensetzt, ist erschütternd. Ärzte, die seit einem Jahr keinen Urlaubstag mehr hatten. Erschöpfte und verzweifelte Jungmediziner, die als einzigen Ausweg die Kündigung sehen. Arbeitstage, an denen spät in der Nacht die letzten E-Mail-Anfragen beantwortet und Rezepte geschrieben werden. Die Angst vor einer Ansteckung.
Markus Liebig* sitzt auf seinem Wohnzimmersofa, leicht vornübergebeugt an seinem Laptop. Er redet viel und schnell, seine Gedanken überstürzen sich in diesem Videogespräch. Liebig ist mit Leib und Seele Hausarzt. Aber er ist verzweifelt. Normalerweise ist er es, der hilft und Mut macht. Er hat seine Praxis seit einigen Jahren und nimmt seine Arbeit ernst, er macht Hausbesuche, betreut chronisch Kranke. „Ich und viele meiner Kollegen sind verzweifelt“, sagt er. „Wir ersticken in Arbeit. Wir dürfen aber nicht krank werden. Auch haben wir kein Anrecht auf Urlaub – es gibt viel zu wenige Hausärzte für Vertretungen. Wir sind einfach müde!“
Liebig behandelt und hilft täglich rund 50 Patienten, stellt Krankschreibungen aus, schreibt Rezepte, spült Ohren aus, hört zu, testet Patienten auf Corona. Dazu kommen zeitgleich nahezu ebenso viele Anrufe und E-Mails, die müssen alle zurückgerufen und beantwortet werden. Dazu ist ein Hausarzt verpflichtet. Seit einem Jahr wird er mit Anfragen überflutet „wie von einem Tsunami“. Wie ist das mit der Quarantäne? Wann krieg ich einen PCR-Test? Warum kann ich nicht sofort krankgeschrieben werden? Wann komm ich aus der Isolation raus? Und, wann komm ich mit der Impfung dran? „Wenn ich all diese Fragen beantworte, zugleich die Kontakte eines positiv getesteten Patienten verfolgen und in das System einspeisen soll und nebenbei all die anderen Patienten zu betreuen habe, die nicht Covid-19 haben, dann wird das irgendwann einfach viel“, sagt Liebig. Er habe oft nicht mehr die Zeit, mit den Patienten ausgiebig zu reden. Die Medizin, sagt er, leide in dieser Pandemie. „Es ist oft keine gute Medizin, aber das ist zwangsläufig das Ergebnis unserer Überforderung.“
Markus Liebig hat seit einem Jahr keinen Tag Urlaub gemacht. Als er selbst drei Wochen in Quarantäne war, hat er von zu Hause aus weitergearbeitet, irgendwie. Viele Hausarztkollegen, sagt er, leiden unter Schlafstörungen, einige spielen mit dem Gedanken, den Job an den Nagel zu hängen. „Es gibt keine Perspektive“, sagt Liebig. Auch deshalb hat er den offenen Brief mitunterschrieben. „Wir sind gewiss keine Jammerer. Aber der Druck, der auf uns lastet, ist massiv. Dieser Brief ist ein Hilferuf.“
Einer der zentralen und häufig gehörten Kritikpunkte betrifft die landesweite Meldeplattform, die von den Hausärzten zur Kontaktverfolgung und zur Verhängung und Verlängerung von Quarantänen genutzt wird. Noch zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr mussten die Hausärzte jeden Verdachtsfall per E-Mail beim Hygienedienst melden. Schließlich machte sich die Südtiroler Informatik AG daran, eine eigene Plattform zu programmieren.
Seit Herbst weisen die Vertreter der Hausärzte in den Taskforce-Sitzungen regelmäßig auf die konkreten Schwachstellen des Systems hin. Vieles sei „unnötig kompliziert“, um beispielsweise Schüler einer ganzen Klasse unter Quarantäne zu setzen, benötigt ein Hausarzt oft nahezu eine halbe Stunde. Weil jeder Schüler einzeln ins Programm eingegeben werden muss.
Je unkomplizierter diese Plattform zu bedienen sei, so der Tenor, desto besser könnte man vor Ort arbeiten. Einiges sei in den vergangenen Wochen zwar verbessert worden, aber es gäbe noch sehr viel Luft nach oben. Den Sanitätsverantwortlichen, so heißt es, müsste doch klar sein, „wie wichtig einfach und schnell zu bedienende Systeme und technische Automatisierungen bei der Bekämpfung so einer Pandemie sind.“
Erwin Stampfl* ist seit vielen Jahren Hausarzt. Er mag seine Arbeit und seine Patienten. Er bittet sie in diesen Monaten immer um Geduld, aber oft hat er selbst keine Geduld mehr. „Ich habe keine Aussicht, dass das alles hier ein Ende nimmt“, sagt er. „Ich kann mich nicht mehr erholen. Ich habe seit einem Jahr durchgearbeitet.“ Bis spätabends sitzt er am Computer, beantwortet E-Mails – an manchen Tagen sind es bis zu 200. Manche Patienten sind erstaunt, wenn er sie nach 21 Uhr noch telefonisch kontaktiert.
Stampfl wundert und ärgert sich über vieles. Bis vor der Pandemie sei die Arbeit der Allgemeinmediziner von Sanitätsbetrieb und Politik wenig geschätzt worden. Jetzt plötzlich sei man zu ihren direkten Ansprechpartnern geworden, „auf einmal werden wir wertvoll“, sagt er. „Sie wissen, dass es ohne unsere Hilfe in dieser Krise nicht geht.“ Der offene Brief enthalte deshalb sehr viel Wahres, sagt er. Trotzdem hat er ihn nicht unterschrieben. Langfristig könnte man sich eine Chance verspielen, die Arbeitsbedingungen der Basismediziner für die Zukunft zu verbessern. Das Duo Zerzer-Widmann, sagt Stampfl, sei bis vor der Pandemie sehr interessiert für die Anliegen der Hausärzte gewesen. Erstmals nach vielen Jahren habe man das Gefühl gehabt, dass es da in Politik und Betrieb jemand ernst meine mit der viel zitierten Aufwertung der Basismedizin. Dann kam Corona. Und damit das Chaos.
Erwin Stampfl wünscht sich eine gute Partnerschaft zwischen Betrieb und Hausärzten. Dazu gehöre eine transparente und offene Kommunikation, eine, wo man vor den Medien über bestimmte Maßnahmen und Beschlüsse informiert werde. Die Forderungen der Hausärzte, sagt Stampfl, liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch. Es sind immer dieselben. „Wir brauchen nicht mehr Geld, wir sind zufrieden. Aber wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Personal für Sekretariat und Pflege, um schnell und effizienter arbeiten zu können.“ Der Betrieb könnte etwa jeder Hausarztpraxis eine Sekretariatsstelle finanzieren.
Die Sekretärin in Stampfls Praxis ist an Covid-19 erkrankt. Seit mehr als einem Monat fällt sie schon aus, da sie sich noch nie von der Krankheit erholt hat. Er muss jetzt alles selbst erledigen.
Die Corona-Krise legt sich wie ein Vergrößerungsglas auf viele bestehende Probleme, sie bringt sie nun in aller Deutlichkeit an die Oberfläche. Zwar war in den vergangenen Jahren immer wieder von der Aufwertung der Allgemeinmedizin die Rede, doch mehr als schöne Worte gab es nicht. Im Grunde genommen wurden die Hausärzte immer wieder zu Medizinern zweiter Klasse degradiert. Viele fühlen sich als „Sekretäre der Krankenhausärzte“, ja, als „Rezepteschreiber“. Krankenstände und Verschreibungen müssten auch Fachärzte im Krankenhaus direkt ausstellen. Viele aber leiten die Patienten hierfür einfach an den Hausarzt weiter.
Die meisten Hausärzte wünschen sich Primare, von denen sie sich verstanden und vertreten fühlen. Primare, die selbst Hausärzte sind und den praktischen Alltag kennen. Das aber ist nicht der Fall. Auch so ein Kritikpunkt, der in den vergangenen Jahren stets angesprochen wurde. Ergebnislos. „Wir Hausärzte“, sagt Erwin Stampfl, „sind ein inhomogener Haufen. Uns fehlt die Schnittstelle zum Krankenhaus, weil wir Primare der Basismedizin haben, die selbst keine Basismediziner sind.“ Würde sich das endlich ändern, dann würden die Hausärzte bestimmte Entscheidungen und Maßnahmen sehr viel mehr mittragen.
Michael Emmerich* empfindet das auch so. Der Allgemeinmediziner ist sein halbes Leben schon Anlaufstelle für seine Patienten, bietet ihnen Hilfe und Orientierung, ist für sie in allen gesundheitlichen Fragen da, von der Kinderkrankheit bis zum Rheuma. Er ist jemand, der stets das Gute will, der aber auch nicht mit harten Worten spart. Emmerich erzählt:
„Wir arbeiten vor uns hin, jeder für sich allein, völlig isoliert. Früher hatten wir oft untereinander Treffen, bei denen man sich ausgetauscht hat. Dafür fehlt jetzt schlicht die Zeit. Wir arbeiten rund um die Uhr und haben am Ende eines Tages trotzdem das Gefühl, nicht wirklich etwas geleistet zu haben. Unsere eigentliche Arbeit wird mit unnötigen Schreibarbeiten und unzähligen Telefonaten zugeschüttet. Ich teste zehn Personen in 20 Minuten, das geht mittlerweile relativ schnell. Danach aber bin ich zwei Stunden nur damit beschäftigt zu telefonieren. Das Ganze ist völlig absurd! Wir strampeln uns ab und reiben uns auf. Ein Problem ist, das wir keinen Einblick haben, was sich in den Krankenhäusern zurzeit abspielt, wir kriegen null Informationen. Wenn ich für einen Patienten eine Facharztvisite organisieren will, muss ich oft regelrecht darum betteln. Am Ende können wir als Hausärzte Löcher stopfen, vieles wird auf uns abgewälzt.
Was ganz schlimm ist: Die Informatik ist eine Katastrophe, wahnsinnig träge – schon seit Jahren. Schlimm ist auch die Kommunikation mit dem Sanitätsbetrieb. Wir werden einfach nicht gut informiert. Das meiste erfahren wir aus den Zeitungen. Diese Kommunikation von oben, diese Ankündigungspolitik, stört viele. Das führt zu einem gegenseitigen Misstrauen. All das summiert sich im Alltag zu einer nicht unerheblichen Zusatzlast. Irgendwann ist man nicht mehr so belastbar. Viele von uns betreuen als Amtsarzt die Altersheime mit. Da ist man täglich im Telefonkontakt und bei Visiten. Wir verspüren oft eine große Hilflosigkeit, wissen nicht, was wir wie tun sollen. Meine Arbeit bis vor der Pandemie war eine völlig andere. Ich kann Kolleginnen und Kollegen verstehen, die nicht mehr können. Viele von uns haben den Eindruck, jetzt, in der Not, sind wir gut genug, können als Ersatz für vieles herhalten, ansonsten aber bezieht man uns nicht ein. Dieser offene Brief ist ein Hilferuf. Das Schlimmste wäre es jetzt, wenn die Adressaten das Ganze als Blödsinn abtun würden. Sie sollten die Menschen dahinter wahrnehmen, auch mal einen Fehler eingestehen. Lernen tut man nur durch Krisen.“
Generaldirektor Florian Zerzer hat auf den offenen Brief der Hausärzte mit einer Mischung aus Ärger, Unverständnis und auch Enttäuschung reagiert. Bei einer der Task-Force-Sitzungen mit Hausarztvertretern wurde lange darüber diskutiert. Es wurde weniger auf die konkreten Anliegen im Brief eingegangen – in erster Linie brachte Zerzer seinen Unmut zum Ausdruck. „Man muss partnerschaftlich miteinander umgehen, wenn man weiterkommen will“, sagt der Generaldirektor einige Tage später gegenüber ff. Partnerschaftlich, das heißt für ihn, sich an einen Tisch zu setzen und miteinander zu reden. Die Kommunikation mit den Hausärzten, sagt er, liege ihm „sehr am Herzen“. Das sei jetzt nicht bloße Rhetorik. Zerzer: „Ohne Rückhalt der Haus-ärzte haben wir in dieser Covid-Krise keine Chance. Ich kann nicht oft genug Danke sagen für ihren Einsatz und ihre Arbeit, die sie seit einem Jahr leisten.“
Wenn man länger mit ihm über das spricht, was die Basismediziner umtreibt, merkt man, dass eigentlich viel Verständnis da wäre. Der Generaldirektor spricht von der mangelnden Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Territorium, den bürokratischen Hürden, dem mangelnden Personal. Er sagt: „Es ist für mich logisch und absolut notwendig, mich für die Haus-ärzte einzusetzen. Nur wenn Territorium und Krankenhaus gut zusammenarbeiten, erreichen wir eine bestmögliche Versorgung der Bevölkerung.“
Und trotzdem wird man den Eindruck nicht los, Sanität und Hausärzte reden aneinander vorbei. Die Reaktion des Generaldirektors auf den offenen Brief hat viele Allgemeinmediziner ihrerseits verwundert und auch verärgert. „Man hat uns in den vergangenen Monaten anscheinend nicht zugehört“, sagen manche. Andere sprechen von einem „billigen Versuch, von eigenen Versäumnissen abzulenken“, und fragen sich: „Warum schaffen es die Führungskräfte nicht, uns als Verbündete zu betrachten? Wir sind keine Bittsteller und schon gar keine Gegner.“
Fragt man Florian Zerzer, ob die Zusammenarbeit nun einen Knacks bekommen habe, antwortet er: „Ich bin weiterhin für eine Zusammenarbeit bereit und hoffe, dass diese künftig gelingt. Es ist eine Frage des Stils und des Umgangs miteinander. Wir können nicht an einem Tisch sitzen und über Probleme reden und gleichzeitig offiziell eine Watsche kriegen.“
Waltraud Rieder* ist eine junge Hausärztin, sie hat nichts zu tun mit den Verhandlungen und Streitigkeiten. Viele der Protagonisten kennt sie nicht persönlich. Sie mag ihre Arbeit, aber im Moment, sagt sie, sei es schwierig, mal ein bisschen Ruhe zu finden. Sie sei oft gereizt und nervös, auch im privaten Bereich. „Da denke ich mir oft: Das bin doch nicht ich. Ich bin doch eigentlich ganz anders. Aber wahrscheinlich bin ich einfach übermüdet.“
Der Sanitätsbetrieb, sagt Rieder, verlange immer mehr von den Hausärzten. Beispielsweise die Nachverfolgung der engsten Kontakte von positiv Getesteten. Oder das Monitoring-Projekt: Sie und viele ihrer Kollegen sehen darin lediglich eine „Beruhigungspille“ für die Bevölkerung, die aus wissenschaftlicher Sicht jedoch wenig Sinn mache. „Hier würde es einen Test mit möglichst hoher Sensitivität brauchen“, sagt sie. So wie etwa beim PCR-Test. Bei den Antigenschnelltests jedoch sei die Zuverlässigkeit sehr gering. Auch bei der Verhängung und Verlängerung der Quarantäne gäbe es noch immer unzählige Probleme. Ohne offiziell verhängte Quarantäne könne man als Hausarzt keine Krankschreiben ausstellen: „Viele Arbeitgeber stressen die Arbeitnehmer, diese rufen ihrerseits bei uns an, aber wir können auch nur auf den Hygienedienst verweisen“, sagt Rieder. Mit einer automatischen Quarantäne-Dauer von 21 Tagen, so wie viele ihrer Kollegen das bereits vorgeschlagen hatten, könnte man einiges verbessern.
Waltraud Rieder leidet sehr darunter, allein vor sich hin arbeiten zu müssen. „Man wächst nicht, es gibt keinen Wissensaustausch, ich habe Angst, mich fachlich nicht weiterzuentwickeln.“ Sie hat sich verpflichtet, ihre Praxis für zwei Jahre zu übernehmen. Sie weiß schon jetzt, dass sie nach dieser Zeit ins Krankenhaus wechseln wird.
*Name von der Redaktion geändert
Weitere Artikel
-

-

Satellit über Brixen
ff 7/21 über ein neues 5-Sterne-Hotel auf der Plose
-

Digitaler Slam
Poetry-Slam-Landesmeisterschaft
















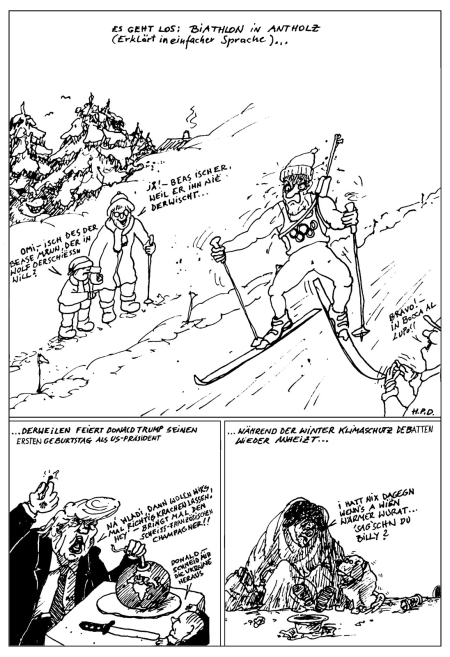




Leserkommentare
Kommentieren
Sie müssen sich anmelden um zu kommentieren.